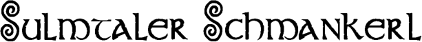02.01.2021
Warum wir nicht bio-zertifiziert sind
Da heutzutage zum Glück vielen Menschen aus unterschiedlichen Gründen bio wichtig ist, wir aber nicht bio-zertifiziert sind, möchten wir hier transparent darlegen, wie wir unseren Hof bewirtschaften. Immerhin sind wir überzeugt davon, dass unsere Betriebsweise oft näher am biologischen Grundgedanken ist, als Richtlinien es vorschreiben würden. Teilweise, und das geben wir auch offen zu, sind wir aber auch weniger bio, als es nötig wäre, um z.B. von der Bio-Austria zertifiziert zu werden. Allerdings gehen die Standards der Bio-Austria auch über die österreichischen Bio-Mindestanforderungen hinaus.
Warum das so ist, und damit alle Interessierten selbst entscheiden können, was sie von unserer Art der Hofbewirtschaftung halten, kommentieren wir kapitelweise in Einträgen der Kategorie „Betriebsweise“ die offizielle Bio-Austria Richtlinie Stand 2020. Dabei erlauben wir uns, den offiziellen Text der Bio-Austria teilweise auf Kernaussagen zu kürzen bzw. zu paraphrasieren und (noch) nicht relevante Kapitel und Abschnitte zu überspringen.
Um es leicht ersichtlich zu machen, in welchen Bereichen wir nicht den Standards der Bio-Austria entsprechen würden, haben wir die Abschnitte farblich markiert. Rot bedeutet, dass wir nicht den Standards der Bio-Austria entsprechen, grün bedeutet, dass wir deren Standards entsprechen. Es ist allerdings zu erwähnen, dass die farbliche Markierung unsere Einschätzung der Situation ist. Wir können nicht garantieren, dass ein offizielles Bio-Austria Audit die Richtlinien gleich interpretieren und zum selben Ergebnis kommen würde.
2. Biologischer Pflanzenbau (S.20-38)
2.1 Allgemeine Bestimmungen:
"Im Mittelpunkt aller Maßnahmen steht der lebendige, gesunde Boden als Voraussetzung für gesunde Pflanzen, gesunde Tiere und damit auch für gesunde Lebensmittel. Wesentliche Prinzipien des biologischen Landbaus sind das Wirtschaften in geschlossenen Kreisläufen und der lebendige Boden als Lebensträger der Erde. [...] Diese Prinzipien wurden von den Schöpfern der biologischen Landbaumethoden, Rudolf Steiner und Hans Peter Rusch, festgelegt."
Sehen und leben wir auch so, wobei die Kreislaufwirtschaft bei uns großgeschrieben wird.
2.1.1 Bodenbearbeitung und Bodenbedeckung:
"Die Bodenbearbeitung ist schonend durchzuführen. Die Verträglichkeit für das Bodenleben und die Bodenstruktur ist bei jeder Maßnahme zu bedenken. Es ist Rücksicht zu nehmen auf die Erhaltung der natürlichen Bodenschichtung, auf die an Zonen gebundenen Arbeitsgebiete von Bodenbakterien und Bodentiere und auf die Gareprozesse. Daher ist tiefes Pflügen ebenso zu unterlassen wie jede Bearbeitung des Bodens in nassem Zustand oder eine zu intensive Bearbeitung."
"Alle diese Maßnahmen schädigen den Humusaufbau und führen zu Nährstoffverlusten wie auch ein längeres Offen-Liegenlassen des Bodens. Es ist daher auf eine Bedeckung in Form von Zwischenfrüchten, Gründüngung, oder Mulchschichten zu achten. Organische Stoffe dürfen nur oberflächlich in den Boden eingearbeitet werden, um giftige Stoffwechselprodukte durch Fäulnis zu vermeiden."
2.1.2 Humuswirtschaft und Düngung:
2.1.2.1 Grundsätzliches: "Der organisch-biologische Landbau ist darauf ausgerichtet, eine gezielte Humuswirtschaft zu betreiben. Die Zufuhr organischer Substanz muss daher langfristig mindestens die Abbauverluste decken."
"Die Düngung hat zum Ziel, die Tätigkeit des Bodenlebens zu fördern. Sie erfolgt ausschließlich mit organischen Düngern. Eine mineralische Ergänzungsdüngung ist in einer Form einzubringen, bei der die Nährstoffe nicht direkt für die Pflanze verfügbar sind, d.h. sie müssen organisch gebunden und dürfen nicht wasserlöslich sein."
"Die Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens sind zu erhalten bzw. zu steigern durch:
- Den Anbau von Leguminosen, Tiefwurzlern, Zwischenfrüchten, Untersaaten, Mischkulturen usw. in einer geeigneten weit gestellten Fruchtfolge.
- Den Einsatz von Wirtschaftsdüngern aus Bio-Tierhaltung oder betriebseigenen organischen Substanzen, die vorzugsweise kompostiert sind.
Die im Betrieb insgesamt verwendete Menge an Wirtschaftsdüngern darf 170 kg Stickstoff ab Lager je Hektar und Jahr landwirtschaftlicher genutzter Fläche nicht überschreiten."
Aufgrund fehlender Datenerhebung können wir (noch) nicht sagen, in welchem Verhältnis die Zufuhr organischer Substanzen zum Abbauverlust steht.
Tatsächlich verwenden wir zum Düngen unserer Gemüsekulturen, welche in Mischkultur und unter Berücksichtigung der Fruchtfolge angebaut werden,
- Mulch,
- eigenen Kompost,
- Schaf- und Hühnermist,
- Schafwolle
- und Holzasche.
Unsere Obstkulturen werden eigentlich gar nicht aktiv gedüngt. Der Obstgarten ist allerdings Teil unserer Weidefläche und wird so eben direkt von den Tieren mit Nährstoffen versorgt.
Die Dauerwiese, auf der wir das Heu für unsere Schafe produzieren, haben wir 2019 und 2020 jeweils 2x gemäht und nie gedüngt. 2020 haben wir im Herbst allerdings das Gras gemulcht und liegen gelassen.
Für 2021 überlegen wir, unsere Schafe zeitweise auf dem Feld weiden zu lassen, um die Gesamtmenge der von den Schafen ausgeschiedenen Nährstoffen auf die Weide und das Feld aufzuteilen. Für genauere Informationen bezüglich des Nährstoffmanagements, siehe Punkt 3.1.1 in Tierproduktion.
2.1.2.2 Aufbereitung und Lagerung von Wirtschaftsdüngern
- Wirtschaftseigene und betriebsfremde Wirtschaftsdünger sind so aufzubereiten, dass sie das Bodenleben fördern. Ein ausreichender Strohanteil, ein guter Abfluss des Sickerwassers und Maßnahmen zur Vermeidung von Verdichtung (Stapelhöhe) verhindern Fäulnis und fördern den Rotteprozess. So kann der Humusgehalt erhalten bzw. erhöht werden. Nicht aufbereiteter Wirtschaftsdünger, unvergorene Gülle und unbelüftete Jauche bringen Fäulnis in den Boden und richten sich gegen die vorher genannten Ziele. Fäulnis muss unter allen Umständen vermieden, Rotte und Gärprozesse hingegen mit allen Mitteln gefördert werden.
- Für die Lagerung von Wirtschaftsdüngern und die Zwischenlagerung auf Feldmieten sind die Vorgaben laut Aktionsprogramm Nitrat i.d.g.F. (siehe unter www.bio-austria.at/duengung) einzuhalten.
- Unsere Waldschafe sind ganzjährig auf der Weide. Wirtschaftdünger von diesen haben wir daher nur aus deren eingestreutem Weiden-Unterstand. Aus dem Stall haben wir nur Einstreu, sollten die Schafe in Notfällen in diesen gebracht worden sein.
- Unser Hühnerstall ist mit Sägemehl eingestreut, sehr trocken und wird trocken gelagert, bis wir ihn beim Pflanzen von Starkzehrern in die Erde einbringen.
- Kompostiert wird außerdem Grünschnitt, Gras, Laub und was sonst noch so im Garten und am Hof anfällt.
- Tierjauche haben wir keine.
- Im Frühjahr wird der strukturreiche Mist/die Einstreu nach 3-monatiger Ablagerung aus dem Tiefstreuunterstand der Schafe für Gemüse mit langer Kulturzeit (Kohlgewächse, Tomaten, Kartoffel, Stangenbohnen, Kürbis, Paprika, Tomatillos, Physalis, Lauch, Knollensellerie) in Form einer Mulchschicht/Flächenkompost direkt ausgebracht. Der Rest wird kompostiert. Den trockenen, sägespanreichen Hühnermist bringen wir beim Setzten von Starkzehrer mit ein.
2.1.2.4 Einsatz von betriebsfremden organischen Düngemitteln
Verwenden wir nicht.
2.1.3 Fruchtfolge, Saatgut und Sortenwahl:
2.1.3.1 Fruchtfolge und Sortenwahl: "Die Fruchtfolge spielt im biologischen Landbau eine zentrale Rolle. Nährstoffversorgung, Krankheits- und Schädlingsdruck, Verunkrautung sowie Bodenstruktur und Humusgehalt stehen in enger Beziehung zu ihr."
"Für den Anbau müssen Arten und Sorten verwendet werden, die dem Standort angepasst und möglichst vital und widerstandsfähig sind. Wenn möglich, sollten nicht-hybride Sorten verwendetwerden, um die genetische Vielfalt unserer Kulturpflanzen zu erhalten. Die Verwendung von CMS-Hybriden (cytoplasmatische männliche Sterilität), die aus Proto-plasten- oder Cytoplastenfusion hervorgegangen sind, ist im Gemüsebau nicht zulässig."Ja, wir setzen auf Mischkultur und Fruchtwechsel. Hybrid-Pflanzen kaufen wir nur sehr selten, sollte die eigene Anzucht einer Kultur nicht funktioniert haben.
2.1.3.2 Saatgut, vegetatives Vermehrungsmaterial und Jungpflanzen: "Es darf nur Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet werden, das gemäß den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft erzeugt wurde. Saatgut stammt primär von BIO AUSTRIA-zertifizierten Betrieben. Die in Bio-Qualität erhältlichen Sorten finden Sie in der rechtlich verbindlichen Saatgutdatenbank der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, kurz AGES, unter www.ages.at. Wenn am Markt kein entsprechendes biologisches Saatgut oder Pflanzkartoffeln erhältlich sind, muss vor dem Anbau eine Genehmigung zur Aussaat von konventionell unbehandeltem Saatgut bei der Kontrollstelle eingeholt werden.Jungpflanzen: Es dürfen nur Jungpflanzen verwendet werden, die biologisch erzeugt wurden. Dies betrifft auch alle Gemüsejungpflanzen."
Das Saatgut, das wir nicht selbst produzieren, kaufen wir ausschließlich als samenfestes Bio-Saatgut von Betrieben wie der Arche Noah, Dreschflegl und Reinsaat. Die wenigen Pflanzen, die wir bei Ausfällen unserer eigenen Anzucht zukaufen, versuchen wir in Bio-Qulität zu kaufen. Ausnahmen ergeben sich selten aber doch teilweise beim kurzfristigen Kauf von regional verfügbaren Jungpflanzen. Hier sind wir noch auf der Suche nach einem regionalen Bio-Jungpflanzen-Betrieb.
2.1.4 Pflanzenschutz:
2.1.4.1 Vorbeugender Pflanzenschutz: "Zum Schutz der Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen dienen neben den direkten Maß-nahmen vor allem solche des vorbeugenden Gesundheitsschutzes. Letzteren ist besonderes Augenmerk zu schenken. Sie umfassen:
- Geeignete Arten- und Sortenwahl
- Förderung der Bodengesundheit
- harmonische Ernährung der Pflanzen
- geeignete Anbau- und Kulturmethoden wie Fruchtfolge, Mischkultur, Gründüngung, Bodenbearbeitung
- Förderung von Nützlingen durch Erhaltung und Schaffung geeigneter Lebensbedingungen (Hecken, Nistplätze u. ä.).
Ja, machen wir alles nach bestem Wissen und Gewissen wobei man zugegebendermaßen nie auslernt.
2.1.4.2 Nicht erlaubte Pflanzenschutzmittel: "Die Verwendung von naturfremden, chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Wachs-tumsregulatoren, Welkemitteln sowie gentechnisch veränderten Organismen (GVO) bzw. deren Derivaten ist untersagt."
Verwenden wir nicht.
2.1.4.3 Pflanzenschutzmittel: "Es gibt eine Liste an Wirkstoffen, die lt. Bio Austria erlaubt sind.
Das einzige zugekaufte Pflanzenschutzmittel, das wir im Rahmen des Gemüseanbaus bisher verwendet haben ist im Biolandbau zugelassenes Schneckenkorn auf Eisen.(III)-Phosphat-Basis. (Siehe auch Betriebsmittel.)
2.1.4.4 Biologische und biotechnische Pflanzenschutzmaßnahmen: "Folgende Maßnahmen können getroffen werden:
- Einsatz natürlicher Feinde von Schadinsekten (Raubmilben, Schlupfwespen und dgl.)
- Insektenfallen, Farbtafeln
- Männchensterilisation
- mechanische Mittel wie: Schneckenzaun, Kulturschutznetze oder Vlies
- Förderung von Nützlingen z.B. durch Nistkästen, Hecken, Büsche, Blütenpflanzen oder Wasserstellen"
Wir verwenden im Obstbau Insektenfallen in sehr geringem Umfang, und im Gemüsebau einen Schneckenzaun. Nützlinge fördern wir derzeit durch den Anbau von Blütenpflanzen im Gemüsebeet. (Siehe auch Betriebsmittel.)
Als nächstes werden wir uns der Pflanzung von Hecken und Schaffung von Lebensraum für Mauswiesel widmen.
2.1.4.5 Pflanzenhilfsmittel: "Folgende Pflanzenhilfsmittel (Pflanzenstärkungsmittel) können eingesetzt werden:
- Algen- und Gesteinsmehle
- Bentonit (Tonerde)
- Kräuterauszüge, Kräuterjauchen und Tees (Brennessel, Schachtelhalm, Rainfarn, Farnkraut, Zwiebel, Meerrettich und dgl.)
- Kompostextrakte
- Kombinationen der genannten Präparate"
Wir verwenden im Gemüsebau Kräuterjauchen.
2.1.5 Unkrautregulierung: "Die Unkrautregulierung hat auf folgende Weise zu erfolgen:
- Pflanzenbauliche Kulturmaßnahmen: Fruchtfolge, Humusaufbau, Untersaat, Zwischenfrüchte, Bodenbelebung
- Mechanische Maßnahmen: Striegeln, Hacken, Bürsten, Mulchfolien oder Vliese
- Abflammen
Die Verwendung von Herbiziden ist untersagt.
Wir versuchen, durch Mulchen mit organischen Materialien das Unkraut zu unterdrücken bzw. entfernen es bei Bedarf per Hand(gerät).
2.1.6 Lagerhaltung:
Die Lagerräume sind so zu gestalten, dass bei Lebensmitteln keine Geschmacks- oder Geruchsverfälschung auftritt und Verderbnis möglichst eingeschränkt ist. Das Umfeld des Lagers ist in einem hygienisch sauberen Zustand zu halten.
Die Lagerung der Lebensmittel ist so einzurichten, dass keine Lagerschädlinge (Insekten, Nager und Vögel) eindringen können (z.B. Vogelschutzgitter bei Fenstern) oder Witterungseinflüsse das Lagergut beeinträchtigen können. Das gelagerte Gut wird regelmäßig kontrolliert und der Lagerraum sauber gehalten. Die Lagerbehandlung des Erntegutes mit chemischen Lagerschutzmitteln (Insektizide, Fungizide) ist grundsätzlich verboten. Für den Bio-Landbau zulässige Lager- und Vorratsschutzmittel für pflanzliche Produkte finden sich in Punkt 2.1.4.3.Das Waschen gelagerter Früchte mit chemischen Reinigungsmitteln, das Nachreifen mit chemischen Substanzen sowie eine ionisierende (= radioaktive) Bestrahlung sind verboten.
Ja, berücksichtigen wir.
2.1.7 Reinigung und Desinfektion: Folgende Wirkstoffe dürfen für die Reinigung und Desinfektion von Gebäuden und Anlagen für die pflanzliche Erzeugung einschließlich der Lagerung in einem landwirtschaftlichen Betrieb verwendet werden:
- Alkohol
- Chlordioxid
- Gesteinsmehle
- Kali- und Natronseifen
- Kaliumhydroxid
- Branntkalk
- Kalk
- Kalkmilch
- Natriumhydroxid
- Mikroorganismen
- Wasser und Dampf
- Natriumkarbonat
- Natürliche Pflanzenessenzen
- Wasserstoffperoxid
- Mechanisch/thermische Behandlungen (z.B. Abflammen)
- Organische Säuren und deren Salze (Zitronen-, Peressig-, Ameisen-, Milch-, Oxal-, Essig- und Benzoesäure)
Wir müssen ehrlich zugeben, dass uns bis zum Verfassen dieses Artikels nicht bewusst war, dass handelsübliche „grüne“ Produkte nicht automtisch die Bio-Kriterien erfüllen. Ob also z.B. das von uns im Einzelhandel gekaufte Ökospülmittel mit den darin enthaltenen Tensiden lt. Bio Austria ok wäre, wissen wir derzeit nicht. Abgesehen davon verwenden wir unseres Wissens nach nur gelistete Mittel.
2.2 Gemüsebau:
2.2.1 Humuswirtschaft
Durch die Art der Bewirtschaftung muss eine positive Humusbilanz erzielt werden. Der Humusgehalt der Böden ist deshalb alle fünf bis sieben Jahre zu überprüfen.
Sehen wir auch so. Wir haben 2020 den Humusgehalt ermittelt und verfolgen aktiv den Humusaufbau.
2.2.2. Düngung – zusätzlich zum Richtlinienpunkt 2.1.2:
Die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern wie Gülle, Jauche und Mist) ist vom Anbau bis zur Ernte (bei mehrjährigen Kulturen bis zur letzten Ernte des jeweiligen Jahres) verboten.
Gülle und Jauche haben wir nicht, da lediglich im Winterunterstand auf der Weide Tiefstreu sowie im Hühnerstall trockener Mist anfällt. Im Frühjahr wird der strukturreiche Mist/die Einstreu nach 3-monatiger Ablagerung aus dem Tiefstreuunterstand der Schafe für Gemüse mit langer Kulturzeit (Kohlgewächse, Tomaten, Kartoffel, Stangenbohnen, Kürbis, Paprika, Tomatillos, Physalis, Lauch, Knollensellerie) in Form einer Mulchschicht/Flächenkompost direkt ausgebracht. Der Rest wird kompostiert. Den trockenen, sägespanreichen Hühnermist bringen wir beim Setzten von Starkzehrer mit ein. Zusätzlich bringen natürlich unsere Hühner und Schafe den Mist ganzjährig auf ihren Weiden (= u.a. dem Obstgarten) aus. Bei der händischen Ernte achten wir aber natürlich darauf, dass das Obst nicht kontaminiert wird.
2.2.3 Jungpflanzenanzucht:
Die im Betrieb benötigten Jungpflanzen müssen selbst angezogen oder von einem anderen Bio-Betrieb gekauft werden. Die Verwendung von CMS (cytoplasmatische männliche Sterilität)-Hybriden, die aus Protoplasten- oder Cytoplastenfusion hervorgegangen sind, ist im Gemüsebau nicht zulässig.
Prinzipiell ziehen wir unsere Jungpflanzen selbst. Sollte dies bei einzelnen Kulturen aber nicht den gewünschten Erfolg versprechen, greifen wir noch auf Produkte lokaler Gärtnereien zurück, die aber nicht bio-zertifizert sind. Bio-Gärtnereien gibt es leider in unserer Nähe unseres Wissens nicht.
2.2.4 Erde und Substrate:
Der Anbau von Gemüse ist nur als Erdkultur erlaubt. Nicht zugelassen sind der Anbau auf Steinwolle, die Hydrokultur, die Nährfilmtechnik und ähnliche Verfahren. Die Wassertreiberei bei Chicoree und Kresse ist möglich. BIO AUSTRIA-Richtlinien für Sprossen und Keimlingsproduktion siehe Kapitel 2.8.
Torf ist für die Jungpflanzenanzucht in Substratmischungen bis zu 70 % der Gesamtmenge erlaubt. Der Einsatz von Torf zur Anreicherung der Böden mit organischer Substanz ist verboten. Ebenso ist die Verwendung von Styromull und anderen synthetischen Stoffen auf Böden und in Substraten verboten.
Die verwendeten Erden und Zuschlagstoffe zu Substraten (z.B. Fertigerden, Rindenprodukte, Fertigkomposte und Kompostmaterial) dürfen keine Zusätze enthalten, die nach den BIO AUSTRIA-Richtlinien zum Pflanzenbau (siehe 2.1.2) nicht zugelassen sind.
Wir kultivieren all unsere Pflanzen in eigener Erde. Somit vermeiden wir prinzipiell auch torfhaltige Produkte. Da uns aber zu Weihnachten 2020 ein Sack torfhaltiger Bio-Anzuchterde geschenkt wurde, werden wir diese verwenden. Nach Möglichkeit werden wir in diesem Zusammenhang einen direkten Vergleichsversuch durchführen, um zu wissen, ob die Jungpflanzen in unserem eigenen Kompost anders gedeihen als in Profi-Erde.
2.2.6 Anbau unter Glas und Folie:
Im Winter (Dezember bis Februar) dürfen die Kulturflächen lediglich frostfrei (höchstens 10 °C) gehalten werden. Die Jung- und Topfpflanzenproduktion bzw. die ausschließliche Beheizung mit nachweislich erneuerbarer Energie (nachwachsende Rohstoffe, Hackschnitzel, Sonnenenergie) und Abwärmenutzung (Agrogasanlagen etc.) sind davon ausgenommen.
Auf eine gute Wärmedämmung der Glashäuser ist zu achten. Künstliches Licht ist (mit Aus-nahme zur Jungpflanzenanzucht) verboten. Gebrauchte Folien, Vliese usw. sind dem Recycling zuzuführen.
Wir verwenden lediglich für die Jungpflanzenanzucht ein Gewächshaus. Für den Rest des Gemüseanbaus verzichten wir auf Gewächshäuser und auch Vliese und Folien, da uns die Verwendung von Kunststoff mit relativ kurzer Lebensdauer nicht sympatisch ist.
2.2.7 Verpackung und Lagerung:
"Die Gemüseverpackung ist so zu wählen, dass einerseits die Erhaltung von Qualität und Frische gewährleistet und andererseits hinsichtlich Aufwand und Material der Verpackung die Umweltverträglichkeit beachtet wird. Styroporuntertassen sind verboten."
Wir verkaufen nur auf Anfrage ab Hof. Dabei weisen wir darauf hin, dass unsere KundInnen selbst Verpackungsmaterial mitbringen.
2.3 Kräuterbau:
2.3.1 Standortwahl
Standorte in der Nähe von Ballungszentren müssen vermieden werden. Der Abstand zu viel befahrenen Straßen (Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen) hat mindestens 50 m zu betragen. Grundsätzlich wird in solchen Fällen das Anlegen eines Heckenstreifens empfohlen. Beim Angrenzen konventionell genutzter Ackerflächen wird ein Mindestabstand von fünf Meter empfohlen. Nach Möglichkeit ist ein Angrenzen konventionell bewirtschafteter Äcker ganz zu vermeiden. Das Anlegen von Schutzhecken wird empfohlen.
Um eine optimale Kulturführung und Krankheitsvorbeugung zu gewährleisten, ist auf eine möglichst weitgestellte Fruchtfolge unbedingt Wert zu legen.
Die nächstgelegene Straße (Bundesstraße) ist von unserer Gemüseanbaufläche ca. 330m entfernt und durch drei Baumreihen abgetrennt. Das nächstgelegene konventionell bewirtschaftete Feld ist ca. fünf Meter entfernt.
2.4 Obstbau (Kern- und Steinobst, Erdbeeren, Strauchbeeren):
2.4.1 Arten- und Sortenwahl:
Die Wahl der Obstarten bzw. Sorten ist mit der Eignung des jeweiligen Standortes in Einklang zu bringen. Dem Umfeld der Obstanlagen sowie den Unterkulturen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken (Blütenpflanzen, Sträucher, Hecken, ...).
Sehen wir auch so.
2.4.2 Kronenaufbau:
Anzustreben sind Bäume mit einem lockeren Kronenaufbau, damit die Blätter und Früchte gut besonnt werden können. Dies gilt besonders bei Anlagen mit Hagelnetzen. Die Bäume sollen sich im Gleichgewicht zwischen Triebwachstum und Fruchtbildung befinden.
Sehen wir auch so.
2.4.3 Begrünung, Bodenbearbeitung:
Eine ganzjährige Begrünung mit standortgerechten Gemengen wird vorgeschrieben. In Gebieten mit ausgeprägter Sommertrockenheit muss eine mindestens zehnmonatige Begrünung gegeben sein. Jedenfalls ist aber ein Umbruch der Begrünung in der Zeit von Anfang September bis Ende März zu unterlassen. Die Mulchschnitte sind nützlingsschonend durchzuführen, z.B. können Randbereiche nicht oder abwechselnd gemulcht werden. Der Humusgehalt sollte eine positive Tendenz aufweisen. Bei Neuanpflanzungen ist auf eine gute Bodenvorbereitung zu achten. Die Baumstreifen können besonders bei Jungbäumen mechanisch offen gehalten oder mit organischem Material abgedeckt werden.
Unsere Obstgärten werden als Weiden für unsere Tiere verwendet, und bleiben somit natürlich ganzjährig begrünt. Umgebrochen wird der Boden nie.
2.8 Sprossen und Keimlinge:
2.8.1 Ausgangsmaterialien:
Zur Produktion von Treibereikulturen und Sprossen müssen die eingesetzten Ausgangs-materialien (Saatgut, vegetatives. Vermehrungsmaterial) biologischer Herkunft sein. Der Einsatz von konventionell unbehandeltem Ausgangsmaterial ist verboten.
Ja, betreiben wir so.
2.8.2 Wasser:
Das für die Anzucht eingesetzte Wasser muss Trinkwasserqualität aufweisen.
Ja, sehen wir auch so.
2.8.3 Substrat und Substratmatten:
Die verwendeten Trägermaterialien und Zuschlagstoffe zu Substraten und Substratmatten dürfen nur Zusätze enthalten, die nach den BIO AUSTRIA-Richtlinien zum Pflanzenbau zugelassen sind. Alle synthetischen Trägermaterialien und Substrate (z.B. Styropor, Steinwolle usw.) sind nicht zulässig
Wir verwenden keine synthetischen Trägermaterialien und Substrate und auch keine Zusatzstoffe.